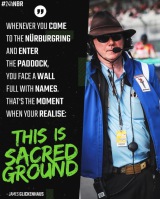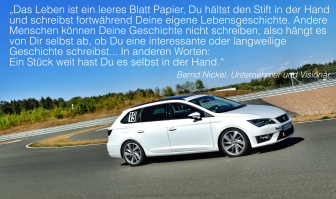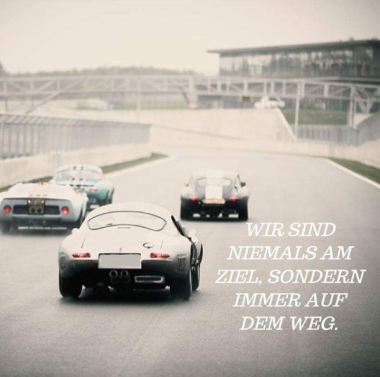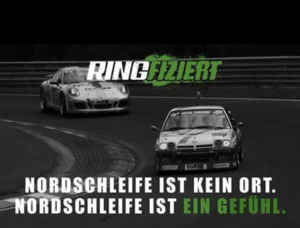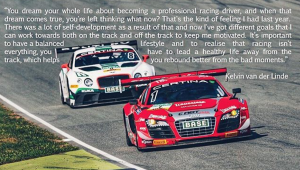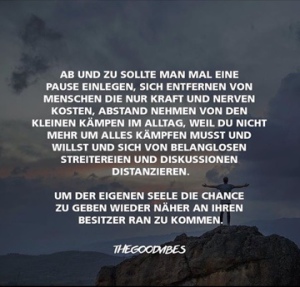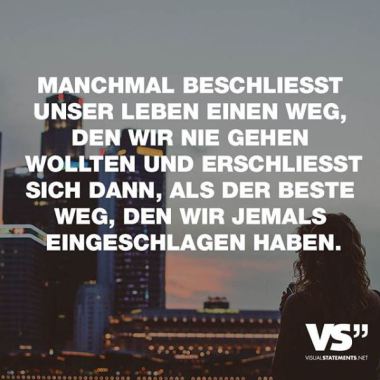aus längst vergangenen Tagen
Die Karmann-Story
Das Hoch im Norden
Karmann ist nicht nur Ghia, sondern auch Ideenfabrik und verlängerte Werkbank: Viele große Marken vertrauten seit 1902 auf die Profis in Osnabrück.
Womöglich saß in Osnabrück der verschwiegenste Automobilhersteller der Welt. Einer, dessen Produkte sich Millionen von Käufern in ihre Garagen stellten, ohne wirklich zu wissen, wer ihr Auto gebaut hatte. Oder - wenigstens zum Teil - konstruiert.
Die Markenzeichen jedenfalls ließen oft keine Rückschlüsse zu, meist half auch ein Blick in den Fahrzeugbrief nicht weiter. Und auch die Presseabteilung verhielt sich niedersächsisch wortkarg.
Tue Gutes, aber rede nicht darüber. Der VW Karmann-Ghia zählt zu den großen Ausnahmen in der Unternehmensgeschichte. Ansonsten aberist seit jeher der Wunsch des Auftraggebers Befehl - gewünscht ist meist Schweigen: So glauben viele Menschen bis heute, das Design des Triumph TR 6 sei in England entstanden oder der erste Prototyp des Alfa Romeo bei Bertone 1961 in Arese bei Mailand. Womöglich fahren sie ihren BMW CS in der Überzeugung, seine Erbauer hätten zur Brotzeit Weißwürste verzehrt. Oder sie meinen, dass ein Mercedes CLK, der nicht aus Sindelfingen kommt, zumindest die ehemaligen Borgward-Hallen in Bremen verlassen haben müsste.
Stimmt nicht. Insider wissen es, und die Tarnung hat Tradition. In den 50ern montiert Karmann DKW-3=6-Cabriolets und Ford-Weltkugel-Kombis in ein und derselben Montagehalle, nur auf parallelen
Fließbändern. Und zu Beginn der 90er hätte ein Vergleichstest der Cabrio-Rivalen VW Golf, Ford Escort und Renault
19 auf jeden Fall einen Punktesieger aus Niedersachsen küren können.
Firmengründer Wilhelm Karmann Senior, dem die Osnabrücker Banken als jungem Karossier jeden Kredit verweigerten, hat den Durchbruch seiner Idee noch erlebt: Kurz vor seinem Tod am 16. August 1952 fährt er das 10.000ste Käfer Cabriolet vom Band. Ein gutes halbes Jahrhundert zuvor ermöglichten ihm erst Geldgeber aus Münster den Kauf einer Kutschenfabrik, deren Produktion er um Automobilkarosserien erweitern kann.
In Amerika hat Karmann die Methoden der Massenproduktion studiert, jetzt ist dem 30-jährigen nach Expansion zumute. Die ersten Aufbauten liefert er an Dürkopp nach Bielefeld, bald darauf bedient er auch Opel, AGA und Minerva. Einen ersten plüschigen Schauraum eröffnet er 1904.
Zum Großserien-Hersteller wird Karmann in den 30ern: Er beliefert Adler in Frankfurt und Hanomag in Hannover. An Ford nach Köln schickt er die Karosserien des Eifel Roadsters, jenes kleinen
Sportwagens, der am Vorabend des Stromlinienbooms die mittelständischen Romantiker in die Salons des Herstellers lockt.
Außerhalb des Tagesgeschäfts realisieren die Karmann-Blechner eine Designstudie des Bauhaus-Architekten Walter Gropius, ein berückend schlichtes Sport-Reise-Cabriolet auf Basis des Adler Standard 8.
Vielleicht fehlt es für die Hautevolee jener Jahre etwas an Pomp, jedenfalls bleibt es bei einer Kleinstserie, die keine überlebenden Exemplare kennt. Ein Neuanfang ist der Bauhaus-Adler trotzdem:
Der Zulieferer in Osnabrück profiliert sich als Haus der schönen Künste, das in den kommenden Jahrzehnten immer wieder den Kontakt zu großen Gestaltern sucht.
Natürlich gehört Luigi Segre dazu, Inhaber der Carozzeria Ghia S.p.A. in Turin, der mit dem Sohn des Firmengründers befreundet ist und 1953 den ersten Prototypen des Karmann-Ghia entwirft. „Wilhelm
Zwo”, wie der junge Chef im Werksjargon heißt, hat sich als Jugendlicher selbst mit Designstudien ins Gespräch gebracht, die sein Vater aber nicht bauen wollte - jetzt aber, als junger Firmenchef im
Autoboom der Fünfziger, holt er auch noch Johannes Beeskow nach Osnabrück, den VIP-Gestalter von Rometsch in Berlin. Zudem zapft er Virgil Exneran, den Chef-Exzentriker des Chrysler-Designstudios,
von dessen Skizzen er sich Anfang der Sechziger inspirieren lässt.
Das Geld dafür ist im Haus, Europas Yuppies lieben das Käfer Cabriolet, von dem Karmann bis zu 100 Exemplare am Tag produziert. Es geht noch auf Karmann Senior zurück, der es 1948 gegen den Willen
des VW Generals Heinrich Nordhoff durchdrückt. Noch nicht einmal einen neuen Standard-Käfer will der für den Umbau eines Prototypen liefern, also besorgt sich Karmann einen Bezugsschein über 850
Kilogramm Stahl und einen jungen Gebrauchten. Nordhoff ist selbst im Angesicht des fertigen Autos noch dagegen, die großen VW-Händler aber erquengeln eine Erstauflage von 1000 Exemplaren in Serie. Es
kommen bis 1980, noch über 330 000 Freiluft-Käfer dazu, was für den Titel des erfolgreichsten Cabriolets aller Zeiten reicht und den bebehenkelten Golf-Nachfolger in den Augen der anonymen
Melancholiker lebenslang zur tragischen Figur macht.
Die Sascha Hehns dieser Welt sichern sein Leben aber immerhin bis 1993, als es fast schon wieder cool ist, einen zu fahren. Ganz im Weiß der 80er Jahre findet das Golf Cabrio seinen Frieden auf jeder
guten Youngtimer-Rallye der Saison.
Volkswagen für Besserverdiener, ein Widersinn der aparten Art - das ist bis tief in die neuere Zeitrechnung die Hauptbeschäftigung bei Karmann. Nebenbei bauen sie in Osnabrück und im neuen Zweigwerk
Rheine aber auch Porsche 356, den frühen 911 und das Einsteigermodell 912. Es entstehen das schlitzäugige BMW-Coupe 2000 CS und die Zweitürer-Version des Opel Diplomat V8. Die Söhne der Erstbesitzer
kaufen sich derweil morsche Gebraucht-Käfer, entsorgen die bucklige Karosserie und basteln sich Buggys aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Karmann zum Bausatzpreis von 2950 Mark liefert.
Noch reizvoller aber sind in jenen Jahren die Studien, die Karmann nicht liefern kann, weil es zwar fertig entwickelte Prototypen gibt, aber auch gesenkte Daumen ängstlicher Konzernregenten. Die
viersitzige Cabrio-Version des VW 1500 Typ 3 etwa bauen die Aufschnitt-Experten 1961 in einer Art Vorserie von 16 Exemplaren, die VW Händler verteilen schon farbige Prospekte, aber Heinrich Nordhoff
ist in letzter Minute doch wieder dagegen.
Sein Nachfolger Kurt Lotz votiert später gegen den einzigen charmanten VW 411, den mit dem elektrischen Verdeck von Karmann, und bügelt zudem eine feingliedrige Offen-Version des ersten Audi 100 ab.
Ohne Chance sind auch das Opel Manta A Cabriolet, das keilförmige Giugiaro-Sportcoupe auf Basis des frühen Audi 80 oder der offene Dreier--BMW von 1976.
Die vertanen Chancen haben Tradition bis in die jüngere Zeit. Auf der IAA 1991 etwa dreht sich mit dem Idea ein deutscher MX-5-Killer auf dem Karmann-Stand. Das wäre er gewesen, der leckere
VW-Roadster, wie er dann mindestens zehn Jahre zu spät auf den Markt kommen wird. Oder auch ein Image-Booster für Ford.
Und statt Roadstern darf Karmann 1997 den ersten Golf Variant mitbauen, als Volkswagen die Nachfrage nicht mehr allein befriedigen kann. Während die Fans vergeblich auf eine Retro-Version des
Karmann-Ghia warten, wird in den Neunzigern die Liaison mit Mercedes enger: Ein Flügeltüren-SL der Baureihe R 129 bleibt 1993 noch ein Einzelstück, das klappbare Blechdach des SLK aber ist kurz
darauf schon eine Auftragsentwicklung aus Osnabrück. Und den CLK baut das Unternehmen ab 1997 komplett - mit und ohne Blechdach.
Zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens rollen die Karmänner ganz kurz sogar Prototypen einer offenen A-Klasse, eines Ford Focus und BMW-3er-Compact-Cabriolets ans Tageslicht.
Genauso schnell sind die Ideenträger dann aber wieder weggesperrt. Es muss ja nicht jeder wissen.
Wie ging es Anfang der 2000er weiter?
Mitte der Jahre zwischen 2000 und 2010 zeigten sich Probleme für die europäischen Auftragsfertiger von Nischenfahrzeugen. Die Beschäftigungssicherungsverträge der großen OEM mit den Gewerkschaften einerseits und die technischen Fortschritte im Fahrzeugbau führten dazu, dass der Bau auch von Nischenfahrzeugen nicht mehr ausgelagert, sondern innerhalb des OEM-Produktionsverbundes erfolgte. Zusätzliche Liquidität wurde benötigt, um die sich abzeichnende Krise bewältigen zu können. Nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsfelder wurden verkauft. Diesem Trend musste auch Karmann folgen.
Nach dem bereits 2000 erfolgten Verkauf der Reisemobilsparte an Eura Mobil wurde die 100 %-Karmanntochtergesellschaft Heywinkel GmbH an den Finanzinvestor Nord Holding Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH aus Hannover veräußert. Weiterhin erfolgte zum 31. März 2008 der Verkauf der brasilianischen Tochtergesellschaft an die Grupo Brasil, einen bedeutenden brasilianischen Autozulieferer. Somit beendete Karmann nach fast 48 Jahren sein Engagement in Brasilien. Wie an den deutschen Standorten in Osnabrück und Rheine wurden nahe São Paulo seit den 1960er Jahren komplette Fahrzeuge gefertigt. Neben Abwandlungen des Karmann Ghia lief zuletzt der in Lizenz gebaute Land Rover Defender vom Band.
Da Audi die Produktion des neuen und vom A5 abgeleiteten Cabrio und auch Mercedes die Produktion des neuen CLK-Cabrios aufgrund der Beschäftigungssicherungsverträge wieder in die eigene Fertigung nehmen wollten, suchte Karmann seit Mitte der nuller Jahre erfolglos nach Anschlussaufträgen für die Fahrzeugwerke in Osnabrück und Rheine. Noch bevor die Fahrzeugproduktion eingestellt wurde, meldete Karmann am 8. April 2009 die vorläufige Insolvenz an. Davon waren auch die mit der Wilhelm Karmann GmbH verbundenen inländischen Tochterunternehmen in Rheine (Kreis Steinfurt) und Bissendorf (Landkreis Osnabrück) betroffen. Als letztes Fahrzeug rollte am 23. Juni 2009 um 11:35 Uhr ein schwarzes Mercedes CLK-Cabriolet vom Band.
In meiner Kindheit / Jugend war Karmann in meiner Heimat DER Top-Arbeitgeber! Jeder, der es sich aussuchen konnte, wollte dort arbeiten... Ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern, die ich als Jugendlicher erlebt habe: Papa war damals mit einem leitenden Mitarbeiter aus der Karmann-Entwicklung befreundet als dieser Anfang der 1980er eines Nachmittags mit einem Scirocco II vorfuhr, der sehr "unrund" lief... "Da ist der neue 16-V-Motor drin - ist VW´s neue Geheimwaffe in der Kompaktklasse..." - zu der Zeit kam kaum einer auf die Idee, dass die Voerventiltechnik ein paar Jahre später den Motorenmarkt gründlich durcheinanderwirbeln wird...